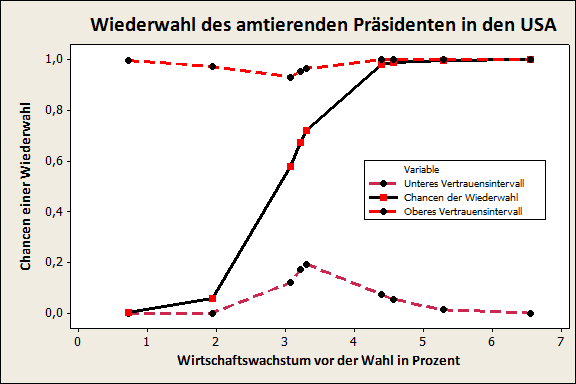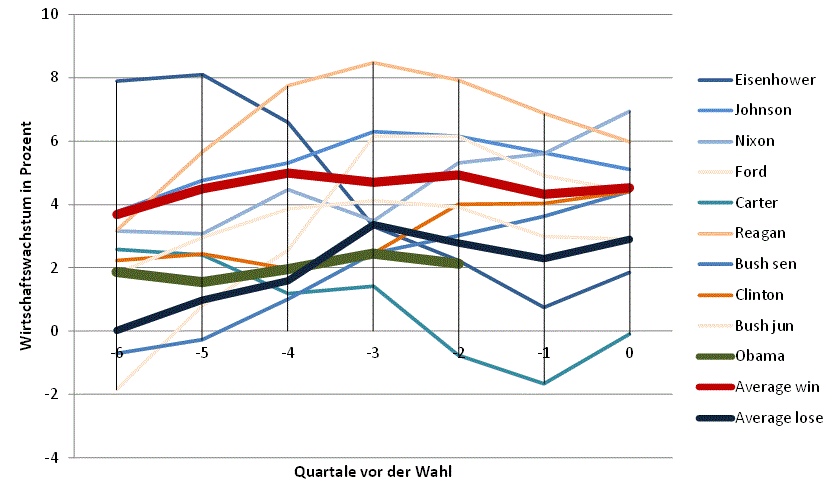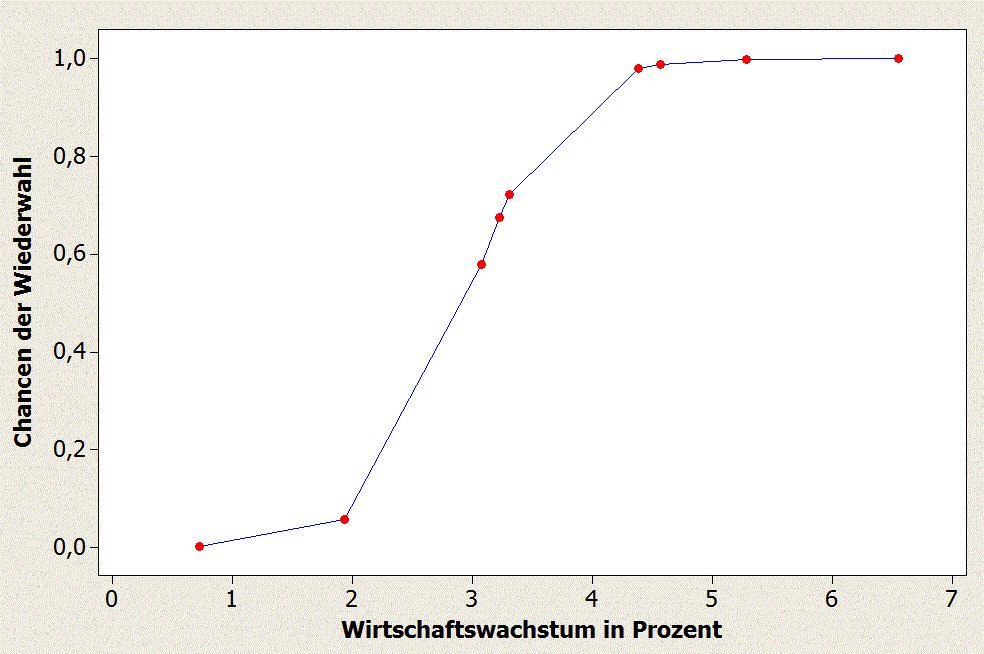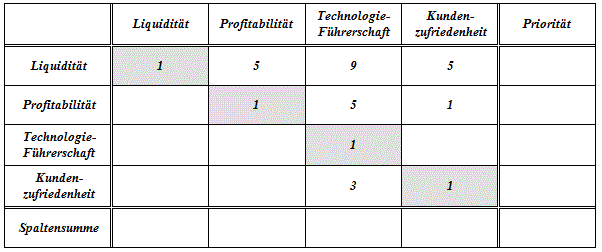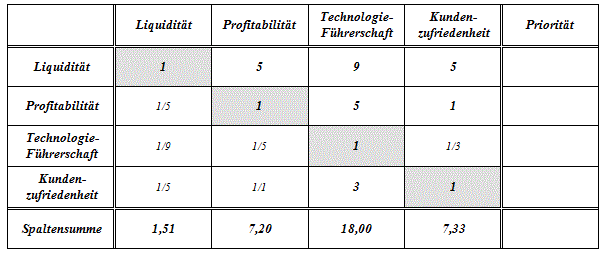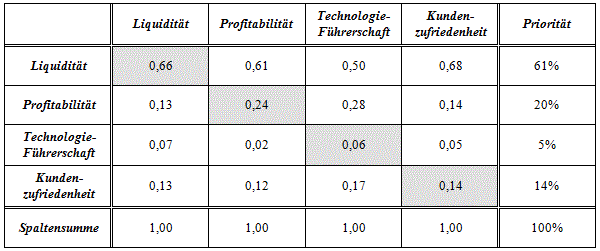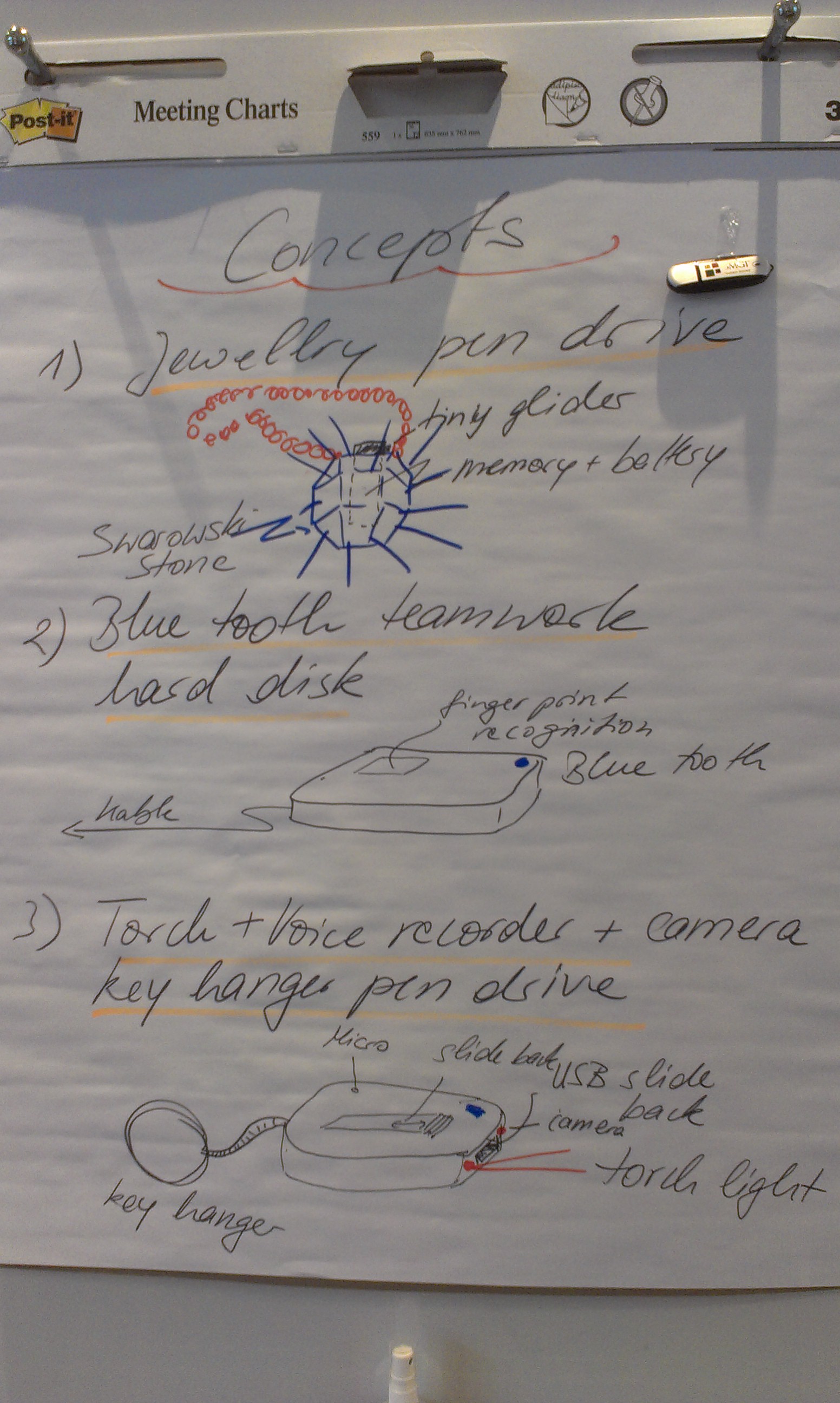„Sobald die Menschheit in der Lage ist, ein Problem zu formulieren, ist sie auch in der Lage, es zu lösen“. Das ist übrigens von Karl Marx (*). Wir müssen also Probleme gut beschreiben lernen. Im Laufe der letzten Jahre habe ich folgende „Kochrezepte“ dafür erstellt.
Formulieren Sie das Problem lösungsneutral.
„Mein Problem ist, ich habe kein SAP – und für SAP gibt’s kein Budget.“ In dieser Formulierung ist das Problem die Abwesenheit einer Lösung. Das engt unsere Kreativität ein. Fragen Sie besser: „wozu bräuchten wir SAP?“ So arbeiten Sie das tatsächliche Problem heraus und können andere, oft bessere Lösungen finden.
Formulieren Sie das Problem proaktiv.
„Mein Problem ist, es regnet zu viel in Hamburg!“ Mit dieser Problembeschreibung mache ich mich zum „Opfer“ äußerer Umstände. Sie inspiriert vor allem Vermeidungsstrategien. „Ich komme viel zu häufig tropfnass bei der Arbeit an“ – solch eine Formulierung öffnet dagegen Handlungsspielräume.
Grenzen Sie das Problem ein.
Hier helfen die aus Schulzeiten bekannten „sieben W-Fragen“ (Wo, Was, Wer, Wann, Warum, Woher, Wie viele) und die von Zielformulierungen her bekannten „SMART-Kriterien“ (spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch, terminiert). Vermeiden Sie aber typische Fehler. Zum Beispiel: „Wer“ heißt nicht: „wer ist daran schuld?“ sondern „wer ist davon betroffen?“
Arbeiten Sie die Natur des Problems heraus.
Verbesserungsprobleme lassen sich immer formulieren als „verbessere über einen Zeitraum eine Metrik von aktuellem hin zum zukünftigen Zustand“. Zum Beispiel: „Reduziere bis zum Jahr 2030 den weltweiten CO2-Ausstoß von derzeit über 4 Tonnen auf unter 3 Tonnen pro Kopf der Weltbevölkerung“.
Wir sind geschult, Widersprüche zu umgehen. Genrich Altschuller hat entdeckt, dass gerade sie uns helfen, den Lösungsweg zu finden. Wir möchten das Fahrrad leicht machen, ohne aber an Stabilität einzubüßen. Das „Lean-Denken“ kennt diese Herangehensweise nicht. Bei „Six Sigma“ ist sie in der „consequential metric“, die „unerwünschte Nebeneffekte“ abbildet, zumindest prinzipiell berücksichtigt.
Es mag auch nur ein Effekt fehlen. Uns ist klar, was getan werden muss. Wir suchen nach dem Wie. Das Eastgate Shopping Center in Harare soll mit minimalem Energieaufwand klimatisiert werden. Termitenhügel nutzen den dazu nötigen Effekt in Perfektion. Die Lösung lautet „Bionik“.
Arbeiten Sie die „ideale Lösung“ heraus.
Genrich Altschuller und viele „Lean-Denker“ haben erkannt, dass wir Lösungen nicht finden, weil wir uns die ideale Lösung nicht vorstellen können: Daten werden von selbst in die Datenbank übertragen, Entscheidungen werden von selbst getroffen, es wird überhaupt keine äußere Energie verbraucht – und so weiter.
Wie verwende ich all das in der Praxis?
Dies ist eine sehr legitime Frage. Wenn es Ihnen hilft, dann bauen Sie sich eine Checkliste aus diesen Punkten. Fügen Sie gerne auch Ihre eigenen hinzu. Machen Sie aber bitte keine „Zwangsjacke“ daraus. Eine Checkliste hilft lediglich, im richtigen Moment die richtigen Fragen zu stellen. Erfahrungsgemäß sollten Sie so häufig auf ein „Heureka“ stoßen, das es weiter zu verfolgen gilt.
Übrigens: erst die Übung macht den Meister…
(*) Ich habe mir allerdings erlaubt, die in den Intellektuellenkreisen der damaligen Zeit übliche Sprache in eine uns heute zugänglichere zu übertragen. Zu finden in: Karl
Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Marx/Engels, Werke, Band 13, Berlin 1969, Seite 9. Original: „Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess des Werdens begriffen sind“.